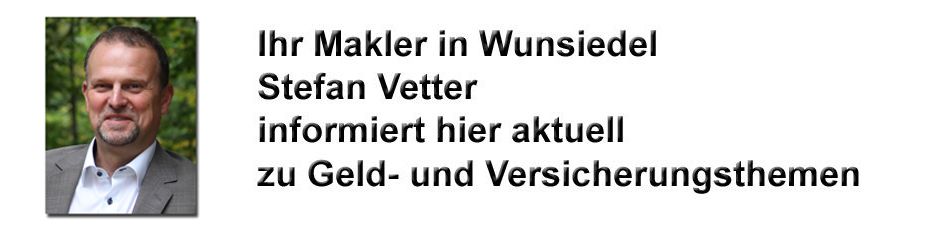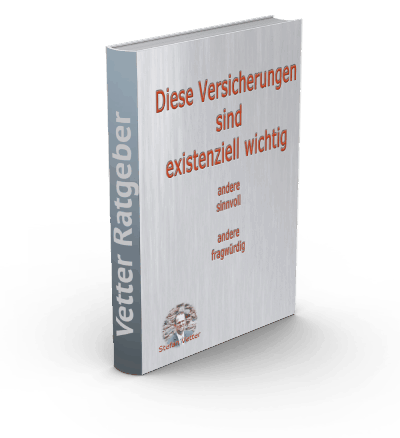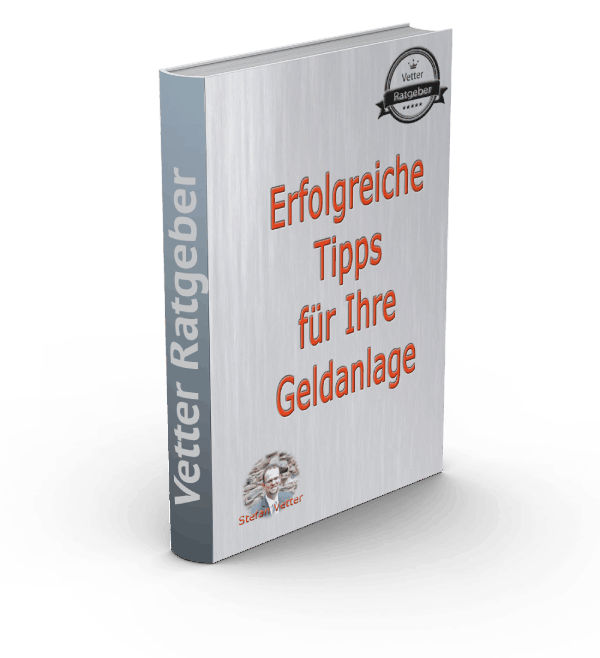Darf Radfahren wegen Trunkenheit behördlich verboten werden?
Ein Mann hatte seine Fahrerlaubnis verloren, da er bereits mehrfach wegen Trunkenheitsfahrten aufgefallen war. Zum Fall: Im Sommer 2019 war er mit einem fahrerlaubnisfreien Mofa unterwegs und stürzte dabei schwer. Eine Blutalkoholuntersuchung ergab eine Konzentration von 1,83 Promille. Aufgrund dieses Vorfalles ordnete die Fahrerlaubnisbehörde eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) an, um die Fahreignung überprüfen zu lassen.
Klage gegen Verbot
Die Behörde untersagte dem Mann schließlich das Führen von Fahrzeugen im öffentlichen Straßenverkehr, auch fahrerlaubnisfreier, da er der Anordnung nicht nachkam. Als rechtliche Grundlage hierfür diente die Fahrerlaubnis-Vorordnung, konkret § 3 FeV. Wie das zuständige Oberverwaltungsgericht Saarlouis mitteilte, wird dem Betroffenen damit auch das Nutzen von Fahrrädern und E-Scootern zur Fortbewegung verwehrt.
Daraufhin klagte der Mann gegen das Verbot vor dem OVG Saarlouis. Er berief sich auf diverse Urteile anderer Oberverwaltungsgerichte mit dem Argument, dass mit § 3 FeV keine tragfähige Argumentation für das ausgesprochene Verbot zugrunde liegt. Die Vorschrift sei entweder in ihrer Anwendung unverhältnismäßig oder zu unbestimmt.
Ähnlicher Fall
So hatte beispielsweise das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz mit dem Urteil vom 20. März 2024 (10 A 10971) entschieden, dass einer Frau, die mehrfach unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und mit dem Rad fuhr, die Nutzung dieses Fortbewegungsmittel nicht untersagt werden könne. Daher bietet § 3 FeV keine klar definierten Maßstäbe bezüglich der Eignung zum Führen fahrerlaubnisfreier Fahrzeuge und verletzt somit das Bestimmtheitsgebot und den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
Gesetze müssen präzise und klar sein
Gesetze müssen so präzise und klar gefasst sein, dass Bürger vorhersehen und verstehen können, was erlaubt und was verboten ist. Diese Angaben erfüllt der betreffende Paragraf nicht. Eine Revision wurde in diesem Fall zugelassen, auch weil die Rechtssache von grundsätzlicher Bedeutung ist.
Das OVG Saarlouis bestätigt Verbot
Im vorliegenden Rechtsstreit entschied allerdings das OVG Saarlouis anders und hielt am Fahrverbot fest. Mit dem Urteil vom 23. Mai 2025 (1 A 176/23) bestätigte der zuständige 1. Senat, dass § 3 FeV im vorliegenden Fall eine hinreichend bestimmte und verhältnismäßige Regelung
darlegt, um dem Mann das Radfahren zu untersagen.
Weiter führt das Gericht mit Verweis auf § 11 Absatz 8 FeV aus, da der Kläger es versäumte sich begutachten zu lassen, hat die Fahrerlaubnisbehörde darauf schließen dürfen, dass ihm die Eignung zur Teilnahme am Straßenverkehr mit erlaubnisfreien Fahrzeugen fehlt.
Schwerwiegender Eingriff in Individualmobilität
Aus diesem Grund stellt die Untersagungsverfügung zwar einen schwerwiegenden Eingriff in die grundrechtlich geschützte Individualmobilität dar, es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass solche erlaubnisfreien Fahrzeuge angesichts der geringeren Masse und Höchstgeschwindigkeit eine niedrigere Gefahrenquelle darstellen als erlaubnispflichtige Kraftfahrzeuge. Die Gefahr, die von ungeeigneten Führern erlaubnisfreier Fahrzeuge ausgehe ist aber erheblich genug, um die Anordnung zu rechtfertigen sich medizinisch-psychologisch begutachten zu lassen.
Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer
Andere Verkehrsteilnehmer können sich und Dritte erheblich gefährden, wenn sie wegen der unvorhersehbaren Fahrweise eines unter Alkoholeinfluss fahrenden Rad- oder Mofafahrers zu riskanten und folgenschweren Ausweich- oder Bremsmanövern verleitet werden, so die Begründung des Gerichts zum Verbot.